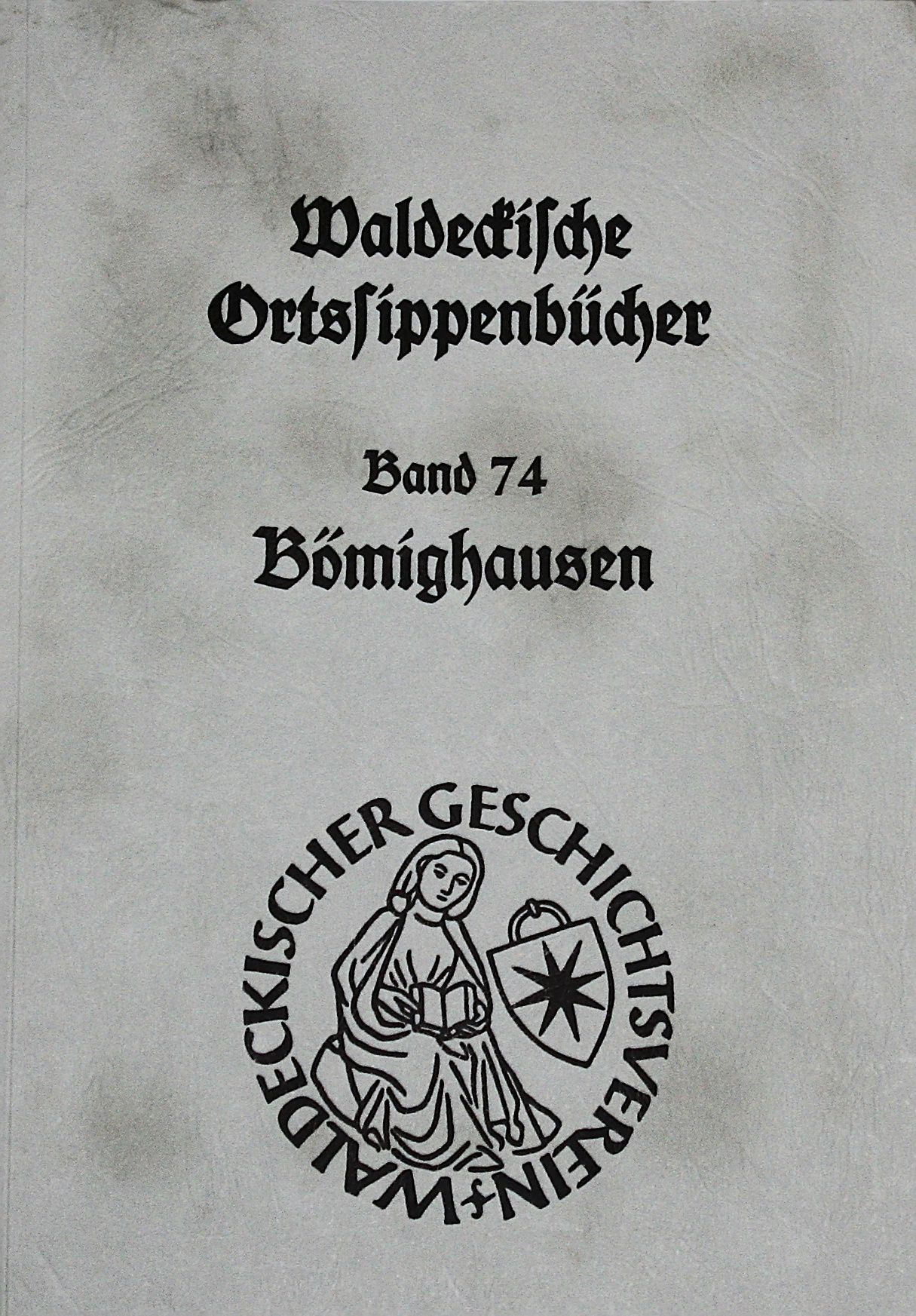1.4.13 Von den Backhäusern im Dorf
Bericht von Karl Schäfer
Welche Hausfrauen könnten wohl heute noch das tägliche Brot selber backen? Wahrscheinlich nur die Frauen über 70 Jahren, die in ihrer Jugendzeit mit im Backhaus waren und beim Backen und den Vorbereitungen beteiligt waren. Sie hatten von der Mutter oder Großmutter noch die Kunst des Backens gelernt. In meiner Jugendzeit gab es im Dorf zwei Privatbackhäuser, je eins hatten Schalk – Schalks und Emde – Jaustes. Ein Gemeindebackhaus stand 10m über dem Einfluss des Stenderwassers in den Neerdarbach. In der NS – Zeit wurde es zu einem Jugendheim für HJ und BDM umgestaltet. Der Gemeindebackofen war natürlich größer als die andern. In ihm konnten zwei Familien zugleich backen. Das Brot reichte dann gewöhnlich für etwa 14 Tage. Je nach Größe der Familien wurden 10 – 12 Teige „eingeschossen“.
Wahrscheinlich hat in früheren Zeiten jeder Hof seinen eigenen Backofen gehabt, war er nun im Kellergewölbe oder als kleiner Bau errichtet worden. Ging das Brot zur Neige, mussten die Vorbereitungen zum Backen anlaufen. Tag und Zeit wurden im Backhaus angeschrieben mit Kreide, der Ortsdiener wurde darüber verständigt. In größeren Gemeinden wurde auch die tägliche Reihenfolge beim Ortsdiener durch das Los entschieden. Am Tage vor dem Backen wurde das vom Müller Behlen gelieferte Roggenmehl zunächst warm gestellt, dann in den Backtrog geschüttet, der Sauerteig wurde hinzu gegeben, Wasser – ja bei manchen Leuten auch etwas Milch hinzugeschüttet. Das Ganze wurde kräftig vermengt und geknetet. Der Teig musste „gehen“, Blasen entwickeln, aufquellen. Er wurde dann mit einem Tuch zugedeckt. Mancher machte noch sein besonderes Zeichen in den Teig, um ihn gut geraten zu lassen.
Das Anbacken am Montag war nicht beliebt, das kostete eine Menge Holz gegenüber geringeren Mengen zu anderen Zeiten. Der Ofen war über das Wochenende kalt geworden.
Ein Arm voll Reisigholz und 10- 13 Scheite „Backholz“ wurden zum Backhaus gebracht, der Ofen wurde gereinigt, das Holz eingelegt und angezündet. War es verbrannt, wurden Asche und Kohlen herausgenommen, die Backfläche gesäubert, die Laibe Teig eingeschoben. Nach kurzer Zeit wurden sie mit dem flachen Schieber wieder herausgezogen. Sie waren schon etwas fest. Mit einem nassen Tuch wurden die Laibe abgewischt und dann wieder eingeschoben. Je nach Hitzegrad dauerte der Backvorgang eine Stunde oder mehr. Waren die Laibe aneinander geschoben worden, entstanden oft die bei den Kindern beliebten „Backauswüchse“, die „Krüstchen.“
In meinem Elternhaus stand seit etwa 1912 ein Küchenherd mit seitlich angebautem Backofen für etwa 6 kleine Brote. In diesem Ofen, der auch mit Holzfeuer auf Temperaturen gebracht wurde, konnte auch gekocht werden.
Von Heinrich Emde. – Mit Aufnahmen des Verfassers, WLK 1965, S. 49f
„Wenn wir die Ölheizung einbauen, dann muss er wohl hinaus...“ „Er ist ein alter gusseiserner Kachelofen, der in der ehemaligen Mühle, dem Hof des Bauern Behlen in Bömighausen steht. Die junge Bäuerin sagt das, und man merkt, es ist ihr gar nicht wohl dabei, dass der Ofen verschwinden soll, obwohl sie ihn täglich putzen und jede Woche wenigstens einmal gründlich auf Hochglanz bringen muss. Öfen wie dieser sind eben nicht nur Wärmespender, sie geben der Bauernstube mit den schweren alten Möbelstücken das gewisse Etwas, ein Gefühl des Geborgenseins in wohliger Wärme und eine anheimelnde Gemütlichkeit. Früher standen sie in jedem Haus. In der Kachel über der großen Feuerung wurde das Essen gekocht, in der oberen Kachel summte der Wasserkessel. So war immer heißes Wasser zu Hand, und wenn plötzlich Besuch kam, konnte schnell ein Tässchen Kaffee aufgegossen werden. In der Kachel wurden auch die „Uowenkoken“, die herzhaft schmeckenden dünnen, runden Ofenkuchen aus geriebenen Kartoffeln gebacken.
Die Zeit der eisernen Kachelöfen ging zu Ende, als die Steinkohle zum bevorzugten Brennmaterial in den Haushalten wurde. Durch den Bau der Eisenbahnen in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts (1800), war es möglich geworden, die Kohle billig bis in die entlegensten Gebiete zu bringen. Nur in den waldreichen Gebieten blieb das Holz noch eine Weile als Heizmaterial konkurrenzfähig. Und wer gar selbst Wald besaß und genügend Buchen einschlagen konnte, der ging nicht so leicht von den bewährten Kachelöfen zum kleinen emaillierten und „ausgemauerten“ Kohlenofen über. Holz war ein „sauberer“ Brand, Kohlenfeuer machte schlechte Luft. Aber nach und nach verschwanden doch die Kachelöfen. Nur wenige haben die „Steinkohlenzeit“ überstanden. Jetzt müssen die letzten der Ölheizung weichen, wie der Veteran in der alten Bömighäuser Mühle.Aber noch steht er, noch wärmt er die Enkel und Urenkel der Ahnen, die ihn vor fast 100 Jahren kauften. Oder wurde er gar auf Bestellung gegossen? Fast möchte man es glauben, denn die Schmuckbilder an den Kacheln deuten auf den Beruf des Käufers hin: Müller und Bauer. Die Schmalseite des Ofens ziert das Relief einer Mühle mit großem Mühlrad und der Wasserrinne. Die beiden Türen der Kachel zeigen links eine Bauernstube mit der Bäuerin, die Kartoffeln schält, und rechts einen Bauern mit Zipfelmütze, der eine Sense dengelt. Die Mühlen an unseren Flüssen und Bächen sind bis auf wenige verschwunden. Wo fließt noch das Wasser über das hohe Holzrad? Wo noch „klappert die Mühle am rauschenden Bach“? Und wo läutet noch das Kling - Kling des Sensendenglers durch den Sommerabend? Heute lärmen die Motoren im Dorf bis in die Nacht hinein. Nur die Arbeit der Bäuerin ist die gleiche geblieben. Sie muss die Kartoffeln auch heute noch mit dem „Ülmeken“, dem kleinen Küchenmesser, schälen wie vor 100 Jahren.